„Der Zigeunerbaron“, so finden wir, ist eine der herausragenden Geschichten des damals noch jungen Sportklettern. In der Handlung geht es um eine besonders geschichtsträchtigen Route: Diese befindet befindet sich im Zigeunerloch nördlich von Graz. Der weit ausladende Überhang wurde im Sommer 1988 von Christoph Grill und Thomas Hrovat erstmals Rotpunkt durchstiegen, auf den Namen „Zigeunerbaron“ getauft und zählte damals zu den schwierigsten Routen Österreichs. Die Bilder stammen von der Begehung des 10-jährigen Christian Leitner der die Routen „Zigeunerbaron 8b“ und „Karies 8b“ jetzt punkten konnte und dabei von seiner Mutter Carmen Leitner fotografiert wurde.
Nur zehn Kilometer von Graz entfernt, liegt am nördlichen Ortsrand von Gratkorn das sogenannte Zigeunerloch – das fünfundzwanzig Meter hohe und zwanzig Meter weit ausladende Portal einer Höhle. Mitte der 1970er Jahre, als es gerade in Mode war, sich mit der Strickleiter von Haken zu Haken fortzubewegen, war es für uns ein beliebtes Ziel. Vor allem an verregneten Tagen genossen wir es, uns von Haken zu Haken bis zur Dachlippe vorzuarbeiten. Durch den riesigen Überhang vorm Regen geschützt, hingen wir in unseren Leitern wie an der Decke eines riesigen Wohnzimmers und hatten, als wir den Ausstieg erreichten, keinen einzigen Meter frei geklettert. Die beiden Routen, die durch das Riesendach führten, zählten zu den schwierigsten hakentechnischen Klettereien in der Umgebung von Graz. Als das Freiklettern immer moderner wurde, interessierte sich niemand mehr für diese Routen. Als einige Haken ausbrachen und sich keiner die Arbeit antat, sie zu ersetzen, wurden sie unkletterbar und das Zigeunerloch begann langsam zu verwaisen. Eine verrußte Feuerstelle, zerbrochene Bierflaschen und Präservative (vielleicht auch das eine oder andere Kind) zeugten davon, daß es inzwischen eine andere Verwendung gefunden hatte.
Ich führe es auf die unglaubliche Junihitze des Jahres 1987 zurück, daß Christoph die Idee hatte, wir sollten das Zigeunerloch einmal frei versuchen. Und ich führe es auf eine Gehirnhautentzündung, die ich mit sieben Jahren hatte und die mich so empfindlich gegen Hitze gemacht hat, zurück, daß ich es für eine gute Idee hielt. Obwohl nur eine Gehminute von der Straße entfernt, stellt das Zigeunerloch eine Welt für sich dar: Selbst im Hochsommer weht ein kühler Wind aus dem Inneren der Höhle und selbst wenn es wochenlang nicht mehr geregnet hat, ist der Fels stellenweise feucht. Vor allem aber leben im Zigeunerloch Tauben, unzählige Tauben und alle sind sie krank. Die meisten sitzen teilnahmslos am Boden herum – tagelang und irgendwann fallen sie um und sind tot. Die wenigen, die noch fliegen können, nisten in den Löchern der Wand.
Nachdem wir den Plafond stundenlang mit dem Fernglas nach Griffen abgesucht hatten, fanden wir im linken Teil des Portals eine Linie, von der wir dachten, daß sie vielleicht frei kletterbar und zu steil für kranke Tauben sei und begannen, Bohrhaken zur Sicherung zu setzen. Mit der Bohrmaschine seilten wir uns in die Wand, die so steil war, daß wir nach wenigen Metern den Kontakt zum Fels verloren. Wir mußten im Seil hängend zu pendeln beginnen, bis wir uns mit der einen Hand irgendwo am Fels festhalten konnten, um mit der anderen Löcher für die Haken zu bohren. Nach zehn Metern wurde der Fels so überhängend, daß wir auch durch Pendeln unmöglich bis zum Fels gelangten und wir mußten uns mit Klemmkeilen und anderen Tricks von der Dachlippe nach innen vorkämpfen, um auch dort Haken setzen zu können. Als nach zwei Wochen endlich alle Haken im Fels waren, waren wir eigentlich reif für ein paar Rasttage, aber natürlich viel zu neugierig, ob es gehen könnte und so haben wir gleich mit den ersten Versuchen begonnen.
Denn unser neues Projekt konnte sich sehen lassen: Auf eine acht Meter hohe überhängende Wand mit kleinen Griffen, folgte ein etwa sechs Meter langes horizontales Dach, an dessen Ende man eine vier Meter lange, etwa 45 Grad überhängende Wand überwinden mußte, um zu einem breiten, nach unten offenen Riß zu gelangen, dem man stark überhängend weitere sechs Meter nach rechts folgen mußte. An einem dünnen Riß mußte man etwa fünf Meter direkt an die Kante des Riesenüberhanges hangeln, wo man in einem Loch einen Fuß verklemmen konnte, um so, mit dem Kopf nach unten hängend zu rasten. Danach folgte eine etwa zehn Meter hohe, überhängende Ausstiegswand, die in der Mitte von einem kleinen Dach unterbrochen wurde. Wir waren stolz auf diese Linie und froh, endlich wieder ein Stück Fels gefunden zu haben, für das es sich lohnte zu trainieren und all unsere Energien zu investieren. Sie übte eine magische Anziehungskraft auf uns aus, und so störte es uns anfangs wenig, daß wir überhaupt nicht weiterkamen. Während der nächsten Wochen verbrachten wir unsere Tage bei den kranken Tauben im Zigeunerloch. Nicht nur, daß wir einen geplanten Kletterurlaub in Südfrankreich absagten, nach einiger Zeit kletterten wir auch keine anderen Routen mehr, sondern hingen nur noch in unserem Projekt herum.
Für gewöhnlich waren Christoph und ich alleine im Zigeunerloch. Eines Tages aber kamen Freunde mit, um sich unser Projekt anzusehen, von dem wir immer gesprochen hatten und wegen dem man uns schon lange in keinem anderen Klettergebiete mehr gesehen hatte. Ihr sonderbares Verhalten versetzte uns den ganzen Tag über in Erstaunen. Während wir uns zwischen den erfolglosen Versuchen wie immer in die Höhle, gut hundert Meter ins Innere des Berges zurückzogen, um dort zu rasten, suchten sie sich einen sonnigen Platz. Als sie uns dennoch einmal widerwillig zu unserem Rastplatz begleiteten, tapsten sie ungeschickt vorwärts, stießen sich an Felsvorsprüngen und stolperten über Steine, während wir uns trotz der Dunkelheit ausgezeichnet zurechtfanden. So sehr uns ihre Unsicherheit erheiterte, so unheimlich war ihnen unsere Sicherheit. Darauf angesprochen, erinnerten auch wir uns an Zeiten, da wir sonnige Plätze suchten und ohne Taschenlampen im Inneren der Höhle hoffnungslos verloren gewesen wären. Die vielen Tage und Wochen, die wir nun schon im Zigeunerloch verbracht hatten, mußten uns irgendwie verändert haben. Das für uns bedenkliche daran war, daß wir selbst diese Veränderungen nicht wahrgenommen hatten, sondern erst durch den Unterschied zu den anderen darauf aufmerksam wurden. Zwar war uns schon vor Tagen eine zunehmende Rötung unserer Augen aufgefallen, die wir auf den Staub, der beim Bohren von Hakenlöcher entsteht zurückgeführt hatten. Doch erst jetzt erkannten wir, daß es sich um keine Entzündungen handelte, sondern daß sich unsere Pupillen ins Rote zu verfärben begannen.
Während der nächsten Tage zwangen wir uns dazu, das Innere der Höhle nicht zu betreten. Ich weiß nicht, was uns mehr Energien kostete: die Versuche am Projekt oder zwischen den Versuchen am Eingang der Höhle sitzen zu bleiben. Unruhig wetzten wir auf unseren Rucksäcken sitzend herum und schielten gierig in das schwarze Loch hinein, das uns aufzusaugen schien. Selbst im Schatten unseres Überhanges, auch bei bewölktem Himmel, mußten wir unsere Augen hinter dunklen Sonnenbrillen verbergen, weil uns das Tageslicht zu sehr schmerzte. Während der ersten Wochen hatten wir versucht, alle Einzelstellen der Route, eine nach der anderen zu klettern und tatsächlich war es uns schon mehrmals gelungen, an jedem Haken rastend bis zum Ausstieg zu klettern. Dabei hatte sich die vier Meter hohe Wand am Ende des Fünfmeterdaches als Schlüsselstelle herausgestellt. Hätte die Route davor geendet, wäre sie immerhin auch 9+ gewesen, aber so folgten noch diese Stelle und danach noch weitere fünfzehn Meter extrem schwieriger Kletterei. Als wir damit begonnen hatten, die Route durchgehend zu klettern, ohne an Haken oder sonstigen Hilfsmitteln zu rasten, waren wir von Versuch zu Versuch ein Stück höher gekommen, bevor uns die Kraft verlassen hatte und wir ins Seil gestürzt waren. Doch nun gab es seit Tagen keinen Fortschritt mehr. Es konnte kein Zufall sein, daß wir seit dem Tag, an dem wir uns gezwungen hatten, das Innere des Zigeunerlochs nicht mehr zu betreten, keinen Zentimeter mehr vorangekommen waren und nun schon seit Tagen in der überhängenden Wand nach dem Dach stürzten, denn die Pausen begannen uns mehr Kräfte zu rauben als das Klettern selbst.
Nach etwa vierzehn Tagen war unser Wille gebrochen. Christoph war gerade wieder einmal an derselben Stelle gestürzt. Ich ließ ihn am Seil zurück zum Boden, wo er wutentbrannt den Seilknoten am Sitzgurt öffnete, seine Sonnenbrille zu Boden warf, und ohne mich zu beachten, auf das Innere der Höhle zuging. Ich löste das Seil von meinem Sicherungskarabiner und lief ihm nach. Doch nicht, um ihn zurückzuhalten, sondern um ihm zu folgen. Auch wenn ich viele Ereignisse aus diesen sonderbaren Tagen bereits vergessen oder gar nicht registriert habe, so ist mir dieser Tag, der Tag an dem wir in die Höhle zurückkehrten, als einer der glücklichsten meines Lebens in Erinnerung. Wie kleine Kinder freuten wir uns und hüpften auf den schlüpfrigen Steinen herum, kletterten die nassen Höhlenwände ein Stück hinauf und krochen in die entlegensten Winkel. Von diesem Tag an hatten wir auch an unserem Projekt wieder Freude – und Erfolg. Zwar war uns die gesamte Route noch immer nicht gelungen, doch immerhin schafften wir jetzt immer öfter die Schlüsselstelle, bevor uns die Kraft ausging. Von nun an verbrachten wir alle Tage im Zigeunerloch, auch die Rasttage, an denen wir nicht kletterten.
Was folgte, ist mir nur noch bruchstückhaft in Erinnerung geblieben und ich bin erst heute, Jahre danach, in der Lage, die Ereignisse zu rekonstruieren. Ich bin dabei vor allem auf Birgit, Andrea, Mutti und Freunde angewiesen, um verstehen zu können, was damals wirklich passiert ist. So erzählen sie, daß Christoph und ich oft tagelang wie vom Erdboden verschluckt waren, um dann völlig verwildert wieder aufzutauchen. Ich weiß nicht, wo wir diese Tage verbrachten, es muß wohl im Zigeunerloch gewesen sein. Ich weiß nicht, wovon wir uns ernährten, es muß wohl von dem sein, was das Zigeunerloch uns gab. Ich erinnere mich nur an die besorgten und fragenden Blicke der anderen, die wir am Weg ins Zigeunerloch oder wieder nach Hause trafen. Als es immer öfter vorkam, daß es plötzlich ruhig wurde, wenn wir einen Raum betraten und alle betroffen zu Boden blickten, zogen wir es natürlich vor, im Zigeunerloch zu bleiben, oder zu Hause in unseren verdunkelten Zimmern von unserem Projekt zu träumen.
So oft wir die Route auch im Kopf geklettert waren, wenn wir sie dann wirklich versuchten, riß jedesmal irgendwo der Film und wir stürzten ins Seil. Wir scheiterten so oft, uns gelang so lange nichts, vielleicht, weil wir es überhaupt nicht schaffen wollten. Denn solange wir dort oben ein Projekt hatten, gab es für uns und vor den anderen einen Grund, ins Zigeunerloch zu fahren.
Es war mittlerweile Hochsommer geworden, und die Kluft zwischen uns und den anderen wurde immer unübersehbarer: Während sie von der Sommersonne immer brauner und brauner wurden, wurden wir immer weißer. Es war dies keine normale Blässe, wie man sie bekommt, wenn man so wie wir den ganzen Tag im Schatten verbringt. Vielmehr wurde unsere Haut wirklich weiß und begann, eine andere Konsistenz anzunehmen. Irgendwie wurde sie glatter und begann zu glänzen. Diese dramatischen Veränderungen, die mit uns passierten, vergrößerten natürlich die Kluft, die uns vom normalen Leben trennte und unseren seelischen Konflikt. Wir liebten die Welt, so wie sie bisher war und wir sehnten uns nach dem normalen Leben, das wir einmal geführt hatten. Doch wir liebten auch das Zigeunerloch, unser Projekt, das Klettern.
In seinem Buch Master oft Rock hatte John Gill, der Vater des Boulderns geschrieben: „Das Bewältigen einer schwierigen Kletterstelle erfordert die völlige Identifikation mit ihr!“ Dieser Satz war für mich zur Maxime geworden, weil auch ich das Klettern als einen Vorgang der Anpassung verstanden hatte, indem man seinen Körper auf die Anforderungen einer Route abzustimmen hat. Auch damals glaubte ich an diesen Satz, auch wenn ich mir eingestehen mußte, diesmal einen Schritt zu weit gegangen zu sein.
Es war wohl dieser seelische Druck, der auf uns lastete, daß wir erneut keine Fortschritte mehr machten. Die meisten Versuche endeten bereits zwei Meter unter dem höchsten bisher von uns erreichten Punkt. Auch körperlich waren wir völlig ausgebrannt. Unter diesen Umständen war es höchst unwahrscheinlich, daß wir in der nächsten Zeit Erfolg haben würden. Einerseits wäre Aufgeben einer Niederlage gleichgekommen. Andererseits hatten wir bereits den Punkt erreicht, an dem wir nichts mehr gewinnen konnten. Denn zu lange hatten wir den Überhang schon versucht, als daß es eine besondere Leistung gewesen wäre, ihn zu schaffen. Unsere Körper waren mittlerweile optimal auf die Anforderungen, die das Projekt an uns stellte, abgestimmt: Unsere Beine waren zugunsten immer stärker werdender Arme schon ziemlich verkümmert, zwischen den Fingern waren uns Häutchen gewachsen, die uns bei abschüssigen Griffen eine größere Auflagefläche und damit mehr Reibung ermöglichten, unsere veränderte Haut schwitzte nicht und so verloren wir keine Kraft mehr durch Nachchalken. Wir konnten selbst im Dunkeln klettern und uns von dem ernähren, was das Zigeunerloch uns gab.
Was half uns das alles, wenn wir uns dafür schämten und wenn der Konflikt, der dadurch entstand, einen Erfolg unmöglich machte? Wir erkannten, daß es keinen Sinn hatte, an einer Welt festzuhalten, zu der wir ohnehin nicht mehr gehörten. Das Zigeunerloch war unsere neue Welt – unsere einzige Welt – und dazu mußten wir stehen, wenn wir nicht als Bewohner zweier Welten zerbrechen wollten. Vielleicht waren wir gar nicht einen Schritt zu weit gegangen, vielleicht hatten wir sogar noch einen Schritt zu wenig gesetzt, weil wir Gills Imperativ viel zu eng gefaßt hatten. Vielleicht mußten wir uns nicht nur körperlich mit unserem Projekt identifizieren, sondern auch geistig. So kam es auch in dieser Beziehung zum Bruch mit der Umwelt. Es war dies der letzte Schritt am Ende eines langen Weges, die letzte Konsequenz, die wir noch nicht gezogen hatten. Man hat uns diesen Schritt nicht schwer gemacht. Nie werde ich den traurigen Tag vergessen, an dem mir meine Mutter verlegen sagte, daß sie Besuch erwarte, mir etwas Geld in die Hand drückte und mich bat, doch ins Zigeunerloch zu fahren. Meine eigene Mutter begann sich für mich zu schämen (Heute kann ich ihr deswegen nicht mehr böse sein, weil ich weiß, daß sie es war, die jeden Morgen eine Schale Milch vor den Eingang der Höhle stellte). Ich fuhr ins Zigeunerloch und blieb – für Wochen! Da wir von niemandem je gesehen wurden, liegt die Vermutung nahe, daß wir erst abends aus der Höhle kamen, um zu klettern. Das für uns wichtigste war, daß unser Leben nun in geregelten und normalen Bahnen lief. Das gab uns die Kraft, endlich zu akzeptieren, was mit uns geschehen war und noch geschehen würde. Hatten wir früher verschämt unsere Hände in den Hosentaschen versteckt, so trugen wir sie jetzt frei, auch kletterten wir jetzt wieder mit nacktem Oberkörper, weil es uns egal war, daß unsere Schulterblätter immer mehr kleinen Flügeln zu gleichen begannen.
Erneut konnten wir all unsere Energien dem Projekt widmen. Immer näher am Ausstieg endeten unsere Versuche im Seil, wo wir laut schnatternd unserem Ärger Luft machten. Schließlich gelang es uns den Bann des „Zigeunerbarons“ (denn so tauften wir die Route) zu brechen. Nie werde ich den Tag vergessen, an dem Christoph als Erster den Durchstieg schaffte. So leicht sah es diesmal aus, daß ich nicht verstand, wieso wir so lange daran arbeiten mußten. Nicht ein Fehler passierte ihm. Es war totenstill. Ich hörte nur sein Schnaufen und ab und zu einen leisen, nur für uns hörbaren Piepser, mit dem er in der Dunkelheit den nächsten Griff ortete, bevor er ihn ansprang. Nach etwa fünfundzwanzig Minuten hängte er das Seil in den Umlenkkarabiner. Aufgeregt gurrte, schnatterte und piepste er vor Freude durcheinander, als auch er nach einiger Zeit realisierte, daß nun endlich der Augenblick gekommen war, auf den wir so lange gewartet hatten. Vier Tage später gelang auch mir der Durchstieg.
Jetzt, da alles erreicht war, fiel auch die große Anspannung, die sich während der letzten Monate aufgebaut hatte von uns, wie ein alter schwerer Mantel. Die Tage wurden immer kürzer und kühler und wir verließen nur noch selten die Höhle und wurden von Tag zu Tag immer müder. Wir wußten, was kommen würde. Wenn der erste Winterschnee Frieden und Stille bringt, würden wir in einen tiefen, tiefen Schlaf verfallen. Und wir freuten uns darauf, im nächsten Frühjahr eine neue Route zu versuchen.
Text: (c) Thomas Hrovat und Bilder: (c) Carmen Leitner









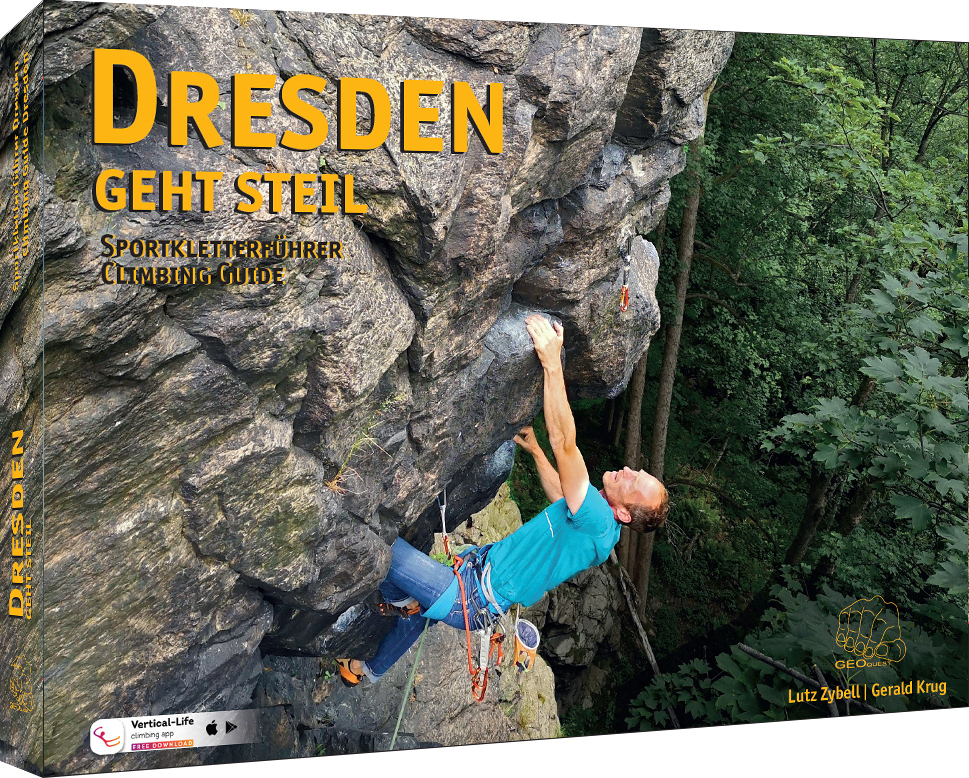
Genau, liebe Helga, weil dein Weltbild nicht zulässt, dass sich Gesellschaften und ihr Blick auf die Geschichte verändern und damit…
Allein die Frage scheint ein perfektes Beispiel eines linksgutmenschlichen Bilderstürmers zu sein. Selbstverständlich sind solche Begriffe nicht rassistisch, sondern die…
Ich reiche hiermit die fehlende Quelle des Direktzitats nach: https://kayakandclimb.blogspot.com/2023/11/free-karma-on-half-dome.html?m=1
Please contact Tobias Wolf via https://kayakandclimb.blogspot.com/ Cheers Gabi
Hi ! well done for the FFA of Charliberté !! I'm looking for a really good picture of this area…